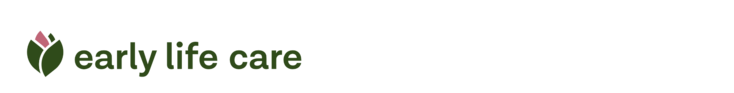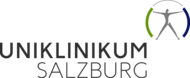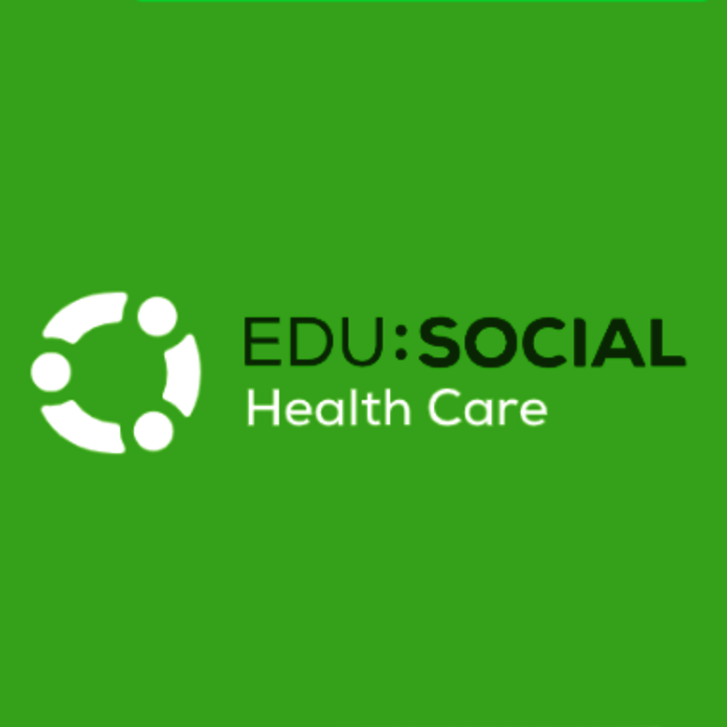Institut für Early Life Care
Institutsleitung // Dr. rer. nat. Beate Priewasser
Wir betrachten die kindliche Entwicklung als ein komplexes Zusammenspiel bio-psycho-sozial-spiritueller Dimensionen. In unseren Grundlagen- und anwendungsbasierten Forschungsprojekten untersuchen wir psychologische Entwicklungsthemen wie Eltern-Kind-Bindung, Eltern-Kind-Interaktion und Early-Life-Stress. Diese verknüpfen wir mit biologischen Parametern für Gesundheit und Krankheit, um zu verstehen, wie psychologische und physiologische Faktoren in der frühen kindlichen Entwicklung zusammenwirken.
Wir arbeiten eng mit dem Early Life Care Universitätslehrgang und dem Early Life Care Zentrum am Uniklinikum Salzburg zusammen. So verbinden wir Forschung, Lehre und Praxis. Mit der Early Life Care Zertifizierung von Einrichtungen tragen wir zur Optimierung der interprofessionellen Gesundheitsversorgung für junge Familien bei. Einen Überblick über alle Angebote von Early Life Care finden Sie unter earlylifecare.at.
Unsere Kooperationspartner
Das Institut ist Teil des young.hope Forschungszentrums für Kinder- und Jugendmedizin des Uniklinikums Salzburg.
Der Universitätslehrgang Early Life Care wird in gemeinsamer Trägerschaft mit dem Bildungszentrum St. Virgil in Salzburg durchgeführt.
Wir sind im Fachbeirat Nationales Zentrum Frühe Hilfen Wien und im Vorstand der German speaking Association Infant Mental Health vertreten.
Ansprechperson
Sie haben Interesse an unserer Forschung oder Frage zu unseren Forschungsprojekten, Weiterbildungs- und/oder Beratungsangeboten? Dann freuen wir uns über Ihre Kontaktaufnahme.