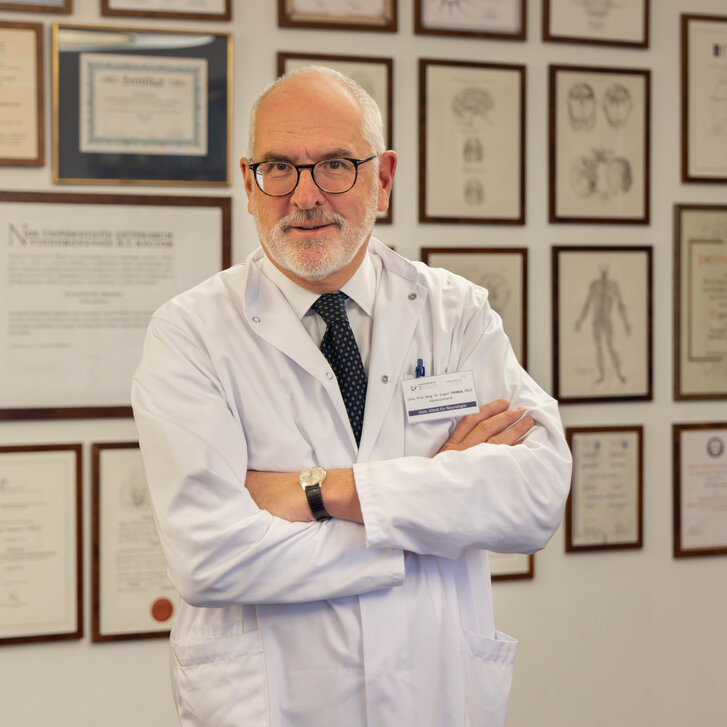Schlaf, Kindchen, schlaf doch bitte!

Einschlafen ist für Babys häufig eine große Herausforderung. Dr.in Adelheid Lang berichtet, wie Eltern ihr Kind am besten unterstützen können.
Vom Neugeborenen bis zum Erwachsenen: Das Gefühl von Sicherheit und Geborgenheit ist eine essenzielle Grundvoraussetzung für gesunden und erholsamen Schlaf. Für ein Baby bedeutet Einschlafen aber auch die Trennung von den Eltern. Um gut (ein-)schlafen zu können, braucht es somit die innere Sicherheit, dass diese noch (rufbereit) da sind, wenn es wieder aufwacht.
Schlaf ist in den ersten Lebenswochen eines Neugeborenen ein Teil der generellen Adaption an die stimulationsreiche Umgebung. Die große Herausforderung für das Neugeborene ist hierbei, seine Verhaltens- und Erregungszustände, die vom aktiven Wachzustand bis zum Tiefschlaf reichen, zu regulieren. Da die Selbstregulationsfähigkeiten des Babys noch sehr eingeschränkt sind, ist die Hilfe der Eltern durch Co-Regulation (z.B beruhigen) erforderlich. Co-Regulation gibt dem Baby Sicherheit und Halt. Eine an die Bedürfnisse, beziehungsweise den Erregungsgrad, des Kindes angepasste Co-Regulation fördert die Eltern-Kind-Beziehung und die Selbstregulationsfähigkeiten des Babys. Diese Selbstregulationsfähigkeiten sind wiederum essenziell für ein späteres Durchschlafen.
Schlafprobleme in den ersten Monaten
Häufig folgen Schlafprobleme in den ersten Wochen und Monaten einem typischen Muster: Obwohl das Baby sehr müde ist, kann es aufgrund von Überreizung und Übermüdung nicht einschlafen und schreit. Aus ihrer Not heraus reagieren die Eltern auf das schreiende Kind mit noch mehr Reizen wie herumlaufen, singen, häufige Lagewechsel oder auch das Einschalten von Staubsauger oder Föhn. Das nun völlig überreizte Baby schläft zwar erschöpft ein, flüchtet sich sozusagen in den Schlaf, erwacht aber nach kurzer Zeit wieder und schreit erneut.
Wie kommt man nun aus diesem Teufelskreis heraus? In erster Linie sollte das Baby nicht durch weitere Reize in den Schlaf gebracht, sondern nur ruhig gehalten werden. Je weniger die Eltern in der Einschlafsituation machen, desto stabiler und länger findet das Baby in den Schlaf. In den Armen der ruhigen und akzeptierenden Eltern ist das (schreiende) Baby sicher. Wird es nur ruhig gehalten und werden Umgebungsreize reduziert (z.B Licht dimmen), so hört es auf zu schreien, wenn es seine Überreizung ablegen konnte. Auf diese Weise kann sich das Baby tatsächlich beruhigen und einschlafen, ohne nach kurzer Zeit gleich wieder schreiend zu erwachen.
Co-Regulation & Feinfühligkeit
Damit Eltern ihr Baby adäquat co-regulieren und beruhigen können, braucht es ihre Feinfühligkeit für kindliche Signale. Feinfühligkeit definierte Mary Ainsworth als das Erkennen und richtige Interpretieren der kindlichen Signale und die adäquate und prompte Beantwortung dieser. Aber: Auch feinfühlige Eltern können Babys mit Schlafproblemen haben. Genetische, sowie prä- und perinatale Einflüsse wirken ebenfalls auf die Regulationsfähigkeiten des Babys.
Wissenschaftlich lässt sich in den ersten drei Lebensmonaten dennoch ein Zusammenhang zwischen der Feinfühligkeit der Eltern und Regulations- und Schlafproblemen des Babys feststellen. Dafür gibt es verschiedene Erklärungen: Eltern, deren Feinfühligkeit den Signalen ihres Kindes gegenüber weniger ausgeprägt ist, haben möglicherweise ein geringeres Repertoire an co-regulativen Beruhigungsstrategien und somit eventuell eine stärkere Neigung zur Überstimulation. Sie wenden also weniger erfolgreiche Strategien an, um ihrem Kind ruhigen Halt und Sicherheit zu vermitteln oder tun sich schwerer, selbst innerlich ruhig zu bleiben. Eine weitere Erklärung wäre eine durch Erschöpfung oder traumatische Geburtserlebnisse belastete Eltern-Kind-Beziehung, die zur Abnahme der elterlichen Feinfühligkeit führt. Auch ein Zusammenhang zwischen der Feinfühligkeit der Eltern und ihrer eigenen Bindungsgeschichte, ihren Erfahrungen mit den eigenen Eltern, kann ursächlich sein.
Aus Co-Regulation wird Selbstregulation – Einfluss auf das Schlafverhalten
Im Laufe des ersten Lebensjahres braucht das Baby immer weniger co-regulative Unterstützung und entwickelt nach und nach Selbstregulationsstrategien. Diese Selbstregulationsfähigkeiten beeinflussen einerseits die Einschlaflatenz („Wie schnell findet das Baby in den Schlaf?“), aber unter anderem auch, wie oft das Baby in der Nacht aufwacht und Beruhigung braucht. Doch wieso ist Selbstregulation für den Nachtschlaf so wichtig? Nach einem abgeschlossenen Schlafzyklus (ca. 1,5 Stunden) kommt das Kind in eine Übergangsphase, bevor es in den nächsten Schlafzyklus startet. In dieser Übergangsphase „erwacht“ das Kind fast und muss wieder zurück in den Schlaf finden, um weiterschlafen zu können. Sollte ihm das nicht gelingen, wacht es komplett auf und braucht die Eltern, um wieder einschlafen zu können. Deshalb gelingt das Durchschlafen unter anderem erst, wenn das Kind diese minimalen Unterbrechungen ohne Hilfe bewältigen und seine unterschiedlich tiefen Schlafphasen miteinander verbinden kann. Das ist einerseits ein Gehirnreifungsprozess, aber kann auch mit der Einschlafsituation zusammenhängen, wie nachstehend erläutert wird.
Schlafprobleme im zweiten Lebenshalbjahr
Die höchste Prävalenz von (elternberichteten) Schlafproblemen findet sich mit etwa acht Monaten. Dies kann einerseits daran liegen, dass die spezifische Beziehung zu den Eltern eine immer größere Rolle spielt (Bindungsentwicklung, „Fremdel-Phase“) und die Trennung in der Einschlafsituation das Baby verunsichert und Verlustängste aktiviert. Diese Phase geht aber vorbei, wenn das Baby die Sicherheit wiedergefunden hat, die es zum Einschlafen braucht. In diesem Alter wird aber auch das Thema Durchschlafen „akuter“, weil Eltern sich verständlicherweise langsam ruhigere Nächte wünschen. Jedoch: Schläft das Kind am Abend mit viel Unterstützung (zum Beispiel Stillen, Tragen etc.) ein, so benötigt es diese Unterstützung sehr wahrscheinlich auch in der Nacht immer wieder, um weiterschlafen zu können. Nämlich dann, wenn es in die oben erwähnten Übergangsphasen zwischen zwei Schlafzyklen kommt. Um Durchschlafen zu ermöglichen, muss hier sanft und schrittweise an der Einschlafsituation gearbeitet werden.
Bindungssicherheit und Schlafprobleme
Schlafenszeit und Nacht sind mächtige Trigger für das Bindungssystem des Kindes, denn diese bedeuten Abschied, Trennung und Alleinsein. Somit wird der Schlaf des Kindes im zweiten Lebensjahr vom Thema “Sich-trennen-können“ dominiert. Das Kind muss jetzt Vertrauen darin haben, dass ein Abschied auch ein verlässliches Wiedersehen beinhaltet. ABER: In diesem Alter kann jede Situation, die eine Veränderung / Trennung beinhaltet, zum Beispiel ein Umzug oder der Arbeitsbeginn der Mutter, zu Schlafproblemen führen. Auch die temporäre emotionale Nicht-Verfügbarkeit der Eltern, weil diese Sorgen oder Ängste haben, kann im Kind Verlustängste auslösen und es kann nicht (mehr) gut schlafen.
Neben diesen Faktoren kann auch das Bindungsmuster des Kindes eine Rolle beim Schlafverhalten spielen. Hierzu gibt es wissenschaftliche Befunde mit objektiven Schlaf-Messmethoden, die zeigen, dass eine sichere Bindung zwischen dem ersten und dem dritten Lebensjahr mit einer besseren Schlafeffizienz assoziiert ist. Schlafeffizienz meint in diesem Zusammenhang, wie viel Zeit schlafend (vs. wach) im Bett verbracht wurde. Bindungssichere Kinder schlafen also, im Gegensatz zu bindungsunsicheren Kindern, tendenziell schneller ein (sowohl abends als auch nach nächtlichem Aufwachen).
Fazit
Auf die Bedürfnisse, beziehungsweise den Erregungsgrad des Babys abgestimmte Co-Regulation gibt Sicherheit und Halt. Um Schlafproblemen in den ersten Wochen vorzubeugen oder diese zu beheben, empfiehlt sich unter anderem die Vermeidung von Überstimulation in der Einschlafsituation. Im zweiten Lebenshalbjahr können altersinadäquate Einschlafhilfen am Abend das Durchschlafen in der Nacht behindern. Zu guter Letzt können sich elterliche Feinfühligkeit und die Bindungssicherheit positiv auf den kindlichen Schlaf auswirken, wobei auch bindungssichere Kinder mit feinfühligen Eltern Schlafprobleme haben können.